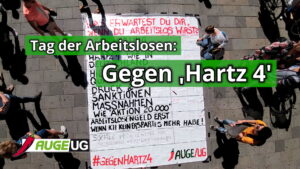der AUGE/UG – Alternative und Grüne GewerkschafterInnen/Unabhängige GewerkschafterInnen
zur 170. Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien, am 26. April 2018
Antrag mehrheitlich angenommen:
FSG, Persp., ARGE, GLB, Kom., BDFA: ja
GA, Türkis: für Zuweisung
ÖAAB, FA: nein
Antragsbehandlung im Ausschuss Frauen- und Familienpolitik
Familienpolitik ist ein wichtiges Instrument um Kinderarmut zu bekämpfen, mehr Chancengerechtigkeit herzustellen, Familien finanziell zu entlasten, Kinder zu fördern und die Einkommenssituation von Frauen – und damit auch von Familien – zu verbessern.
Instrumente der Familienpolitik können dabei direkte finanzielle Transfers, Sachleistungen und Steuererleichterungen sein. Hinsichtlich der Erreichung familienpolitischer Zielsetzungen wirken die jeweiligen Maßnahmen höchst unterschiedlich.
Österreich liegt hinsichtlich der Ausgaben für Familien mit rund 2,6 Prozent des BIP (2013) über dem OECD-Schnitt von 2,43 % aber unter Staaten wie Dänemark, Frankreich oder Schweden. Auffallend ist allerdings der überdurchschnittliche Anteil an finanziellen Transferleistung im Vergleich zu anderen Staaten: so liegt der Anteil finanzieller Familientransfers in Österreich mit 1,9 % des BIP deutlich vor Dänemark, Frankreich und Schweden und auch über dem EU-Schnitt. Hinsichtlich der Ausgaben für Sachleistungen – wie etwa Kinderbetreuungs- und elementare Bildungseinrichtungen – liegt Österreich allerdings unter dem EU-Schnitt und weit hinter erwähnten EU-Mitgliedsstaaten wie Dänemark, Schweden und Frankreich.
Zuletzt rückte die Familienpolitik in Österreich im Zusammenhang mit der Einführung des „Familienbonus“ wieder in den Fokus der öffentlichen Debatte. Mit dem „Familienbonus“ sollen Familien die Einkommensteuer zahlen im Ausmaß von bis zu Euro 1.500 je Kind und Jahr entlastet werden.
Nimmt Österreich bei finanziellen Transfers an Familien auch einen Spitzenplatz in Europa ein, so ist die positive Wirkung derselben hinsichtlich der Bekämpfung von Kinderarmut und der Verbesserung der Einkommenssituation von Frauen tatsächlich hinterfragenswert.
2015 waren laut Eurostat 26,5 % der Kinder und Jugendlichen unter 17Jahren in der EU armuts- und sozial ausgrenzungsgefährdet. In Österreich lag der Anteil mit 22,3 % zwar unter dem EU-Schnitt. Allerdings lagen Staaten wie Schweden (14,5 %), Dänemark (15,7 %), Finnland (14,2 %) und die Niederlanden (17,2 %) deutlich niedriger. Alle diese Länder geben deutlich mehr als Österreich für Kinderbetreuung aus umgekehrt allerdings weniger für finanzielle Familienleistungen. Schweden gab z.B. 2011 2,4 % des BIP für Kinderbetreuung aus, Finnland 1,65 %, Dänemark gar 2,4 %, die Niederlande immerhin 0,89 %. Der Anteil Österreichs an Kinderbetreuungseinrichtungen lag dagegen bei 0,65 % des BIP.
Lag Österreich hinsichtlich der Kinderbetreuungseinrichtungen 1980 noch auf Platz 6 innerhalb der OECD, fiel es bis 2008 auf Platz 25 zurück, um bis 2011 wieder auch Platz 13 aufzurücken. Die Versorgungslücken sind allerdings insbesondere im ländlichen Raum, bei den Unter-3-Jährigen und bei ganztägig und ganzjährig geöffneten Kinderbetreuungs- und elementaren Bildungseinrichtungen groß. Der Mangel an entsprechenden Betreuungseinrichtungen ist ein wesentlicher Grund für den im EU-Schnitt einzigartig hohen Teilzeitanteil von Frauen (EU-28 Schnitt: 31,9 %, Österreich: 47,1 %, Platz 2 in der EU hinter den Niederlanden, Zahlen für 2016). Quellen: Eurostat, OECD
Dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen signifikante Auswirkungen auf die Haushaltseinkommen und damit die Armutsgefährdung der Haushaltsmitglieder hat und entsprechend die Erhöhung der Erwerbsquote/beteiligung eine der wirkungsvollsten Maßnahmen zur Verhinderung von Kinderarmut ist, belegen nicht zuletzt die Zahlen aus dem aktuellen Sozialbericht (2015-2016): Demnach sinkt die Armutsgefährdungsquote in Alleinerzieherinnenhaushalten bei Erwerbstätigkeit der Mutter von 50 auf 25 %, in Mehrpersonenhaushalten mit mindestens drei Kindern von 38 auf 14 %.
Wenn eine hohe Frauenerwerbsquote und -erwerbsbeteiligung das offensichtlich wirkungsvollste Mittel zur Bekämpfung von Kinder- und Familienarmut ist, dann sollte eine moderne, fortschrittliche Familienpolitik insbesondere zum Ziel haben, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Frauen eine möglichst hohe Erwerbsbeteiligung ermöglichen. Dazu sind offensichtlich nichtmonetäre Familienleistungen – wie ein ausreichendes Angebot an Kinderbetreuungs- und elementaren Bildungseinrichtungen – besser geeignet als monetäre vergleicht man die Ergebnisse innerhalb der EU und OECD-Staaten.
Maßnahmen wie etwa der Kinderbonus stellen daher weniger einen Beitrag zu einer Verbesserung der sozialen und finanziellen Situation aller Familien und Familienmitglieder dar, sondern stellen vielmehr eine Maßnahme zur Verringerung der Einkommensteuerzahlung insbesondere für einkommensstarke Eltern mit Kindern dar. Wie wenig es sich um eine „familienpolitische“ Maßnahme zur Verringerung von Kinder- bzw. Familienarmut handelt zeigt alleine, dass weder das Prinzip „jedes Kind ist gleich viel wert“ gilt, noch dass der „Familienbonus“ jenen Familien besonders zugute kommt, die ein nur geringes Einkommen beziehen. Beim Familienbonus handelt es sich dabei nicht nur um eine Maßnahme, die aus verteilungspolitischen Gründen hinterfragenswert ist: Die veranschlagten Kosten zwischen 1,5 und 1,8 Mrd. Euro hätten investiert in Kinderbetreuung, elementare Bildungseinrichtungen und in die Aufwertung von Bildungsberufen zehntausende zusätzliche Betreuungsplätze und entsprechend zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse im elementaren Bildungsbereich geschaffen, nachhaltig die Erwerbschancen und -karrieren von Frauen sowie Bildungs- und Entwicklungschancen tausender Kinder verbessert.
Die 170. Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien möge daher beschließen:
Die Arbeiterkammer Wien fordert eine Neuausrichtung der Familienpolitik die insbesondere die Bekämpfung von Kinderarmut, die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, die gerechtere Verteilung von Familien- und Hausarbeit sowie eine Erhöhung der Chancengerechtigkeit zum Ziel haben. U.a. folgende Prinzipien sind dabei besonders zu berücksichtigen:
- Sachleistungen ist gegenüber Geldleistungen der Vorzug zu geben, wie etwa …
… dem flächendeckenden Ausbau bedarfsgerechter, kostenloser, ganztägig und ganzjährig geöffneter Kinderbetreuungs- und elementarer Bildungseinrichtungen, insbesondere auch für unter-3-Jährige Kinder, verbunden mit einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung.
… dem flächendeckenden, bedarfsgerechten Ausbau ganztägiger Schulformen.
… dem flächendeckenden, bedarfsgerechten Ausbau sozialer Infrastruktur und Dienste wie etwa Pflege- und Betreuungseinrichtungen zur Entlastung pflegender Angehöriger.
- Geldleistungen an Familien sind so zu gestalten, dass dem Prinzip „jedes Kind ist gleich viel wert“ Rechnung getragen wird. Transferleistungen ist aus verteilungspolitischen Gründen dabei grundsätzlich der Vorzug gegenüber Steuerentlastungen zu geben, da diese einkommensstärkeren Gruppen im Verhältnis zu einkommensschwächeren ungleich stärker zugute kommen.
- Gesetzliche Arbeitszeitregelungen sind so zu gestalten, dass sie eine gerechtere innerfamiliäre Verteilung von bezahlter Erwerbs- und unbezahlter Haus- bzw. Familienarbeit erlauben. Dies beinhaltet einerseits sowohl eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung als auch rechtliche Möglichkeiten, individuell, an spezifische Lebenslagen (z.B. Pflege und Betreuung) gebundene Arbeitszeiten bzw. berufliche Auszeiten wählen zu können.
- Jedenfalls abzulehnen sind erleichterte Möglichkeiten, tägliche und wöchentliche Arbeitszeiten auf 12 bzw. 60 Stunden ausweiten zu können, da diese einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie der gerechteren Verteilung von Arbeit zwischen beiden Elternteilen zuwider laufen.